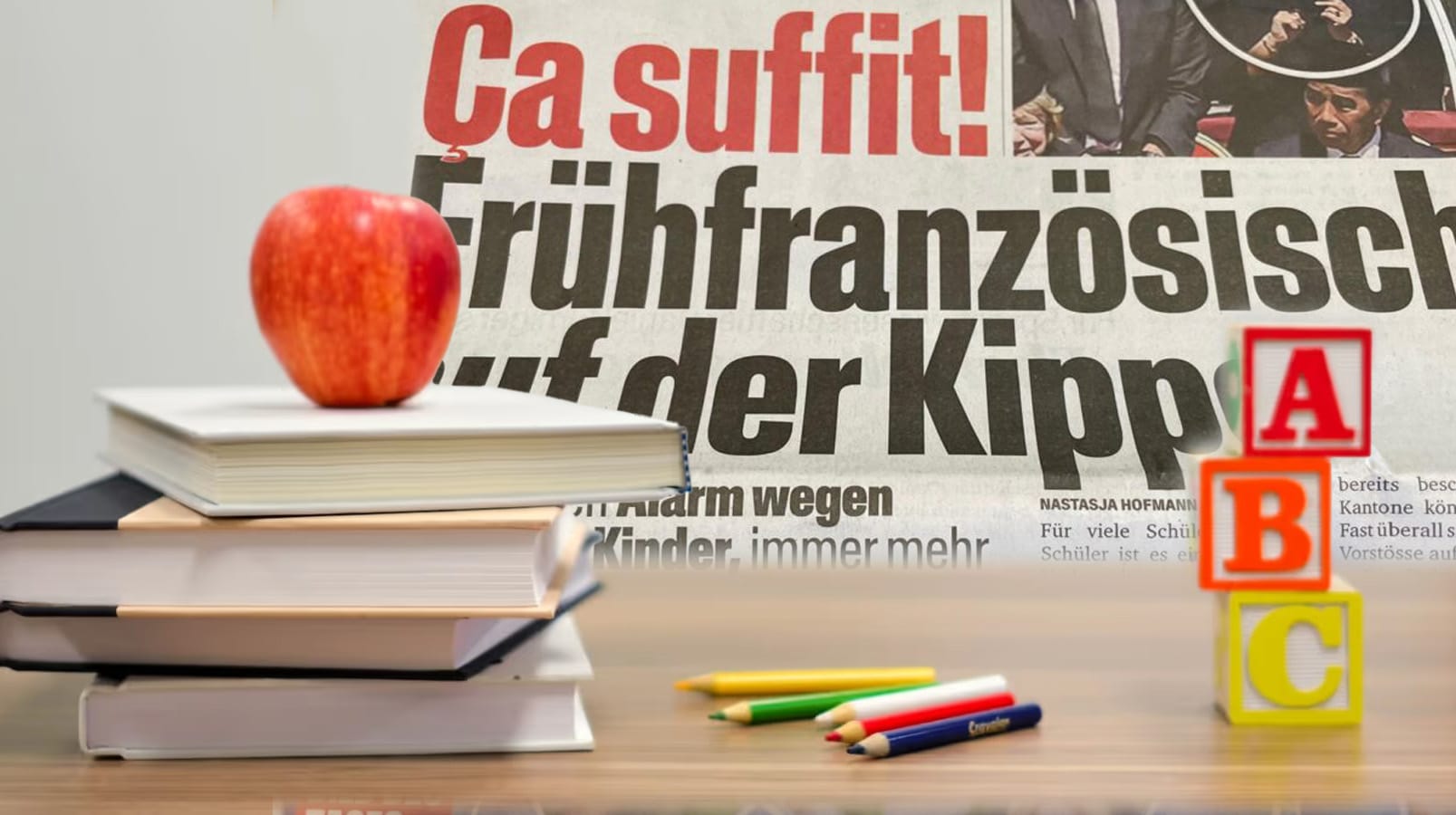«Jedes Kind zur richtigen Zeit in der richtigen Klasse»

Die Herausforderungen im Kanton Aargau sind gross: stetig wachsende Schülerzahlen, sinkende Sprachkompetenzen der Schüler, häufigere Sonderbeschulung und ein politischer Glaubenskrieg über integrative oder separative Beschulung. Mittendrin die neue Aargauer Bildungsdirektorin Martina Bircher, die einen in der Schweizer Bildungslandschaft unvergleichbaren und unverkrampften Veränderungswillen dokumentiert: flächendeckendes Handyverbot, Massnahmepaket gegen den Mangel an Sonderschulplätzen, Massnahmen zur Verbesserung der Sprachkompetenzen von Kindern und so weiter.
LNCH: Die NZZ leitete im Juni Ihr Interview mit den Worten ein: «Die Aargauer Bildungsdirektorin Martina Bircher (SVP) will das Schulsystem verändern. Sie fordert bessere Deutschkenntnisse, mehr Kleinklassen – und weniger Ideologie». Wie geht es Ihnen in einem System, das jahrelang anders eingespurt ist?
Martina Bircher: Sie sprechen das 10-Punkteprogramm an, das auf meiner Homepage zu finden ist! Das Programm gab schon im Vorfeld meiner Wahl viel zu reden und ist inzwischen mit der Bildungsverwaltung gespiegelt worden. Ich musste das Programm nicht anpassen. Nun hängt viel von der Kommunikation ab – insbesondere zum Thema «integrative Schule». Ich hoffe – ja, ich bin überzeugt –, dass ich mit dem Motto «Jedes Kind zur richtigen Zeit in der richtigen Klasse» den Ton getroffen habe und ideologische Gräben überbrücken kann. Jedenfalls sind Grossräte auf mich zugekommen und haben gesagt: «So habe ich es mir noch gar nicht überlegt; ich glaube, wir finden uns.»
Bevor wir über den Richtungsstreit im Kanton Aargau vertieft zu sprechen kommen, nochmals nachgehakt: Wenn Sie neue Ideen formulieren, erfahren Sie in der Bildungsverwaltung Rückenwind oder werden Sie gebremst?
Im Departement bin ich ohne Vorbehalte aufgenommen worden. Jetzt arbeiten wir gemeinsam an einer starken Volksschule im Kanton Aargau.
Es gibt im Kanton Aargau immer mehr Zuweisungen an die sehr separativen Sonderschulen, aber immer weniger Kleinklassen, dies obwohl viele Pädagogen den Integrationsgedanken propagieren. Sie haben unlängst angekündigt, diesen Widerspruch anzugehen. Welche Ursachen sind für diese Entwicklung bereits bekannt?
Wir sind noch immer in der Phase der Analyse. Das Thema ist letztlich sehr vielschichtig. Klar ist, dass es zwischen Primar- und Sonderschulen keine oder kaum mehr Zwischenangebote gibt und dann Kinder an Sonderschulen geschickt werden, die ausserhalb der Wohngemeinde liegen. Das ist separativ. Für mich gilt der Grundsatz: Jedes Kind zur richtigen Zeit in der richtigen Klasse. Ich deute das so: Integrative Schule heisst, dass Kinder im selben Schulhaus, in derselben Gemeinde zur Schule gehen können. Separation ist, wenn Kinder aus der Gemeinde hinaus mit dem Bus an eine andere Schule gehen, die auf spezifische Behinderungsformen spezialisiert ist.
Das hat im Aargauer Parlament aber zu hitzigen Diskussionen geführt.
Ja, die Debatten um die sogenannte integrative Schule sind sehr emotional, sehr ideologisch. Aber es ist doch so: Solange Kinder im selben Schulhaus sind und die Pausen, den Sporttag oder andere Schulanlässe gemeinsam verbringen, findet Integration statt – ob man nun in einer Kleinklasse, in einer ersten oder einer sechsten Klasse ist. Und einer «Kleinklasse» kann man auch «Förderklasse» sagen, wenn das zu mehr Akzeptanz führt. Zurzeit gilt, dass jemand besondere Unterstützung erhält, wenn er kognitiv eingeschränkt ist – wenn also die Wahrnehmung, das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit etc. ungenügend sind. Wir wollen den Förderbedarf breiter fassen. Die Sonderschulen sind heute daran ihr Profil anzupassen, das muss auch die Kleinklasse. Heute weisen die Kinder andere Auffälligkeiten auf als früher.
«Die Debatten um die sogenannte integrative Schule sind sehr emotional, sehr ideologisch. Aber es ist doch so: Solange Kinder im selben Schulhaus sind und die Pausen, den Sporttag oder andere Schulanlässe gemeinsam verbringen, findet Integration statt»
Woran denken Sie?
Beispielsweise an Kinder, die kein einziges Wort Deutsch sprechen. Oder an Kinder, die eine Entwicklungsverzögerung haben. Hier wollen wir flexibler werden und breiter denken und damit auch die Diskussion um integrativ und separativ entspannen.
Das Lehrernetzwerk Schweiz kennt zahlreiche sehr sozial eingestellte Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die am linken parteipolitischen Spektrum anzusiedeln sind. Interessanterweise schwören diese auf separative Angebote, weil nur so gewisse Kinder adäquat gefördert werden können. Wie erklären Sie sich, dass auch im Kanton Aargau ausgerechnet die Linke sich gegen Kleinklassen und Förderklassen ausspricht?
Ich bin noch nicht lange Bildungspolitikerin und kann die Diskussion darum nur vom Ist-Zustand her bewerten: Ich sehe, dass oft sehr ideologisch argumentiert wird. Doch Ideologien helfen den Kindern nicht. Ob man Kleinklasse, Förderklasse, Lerninsel oder wie auch immer sagt, spielt für mich keine Rolle. Integrativ ist letztlich die «Schule vor Ort». Aber da sind schon Glaubenskonflikte in den politischen Lagern entstanden. Selbst das Teilmotto «Jedes Kind … in der richtigen Klasse» wurde kritisiert: Man könne nicht dahinterstehen, bemängelte jemand vom äusseren linken Rand. Sobald man das Kind in eine Klasse einteile, werde es klassifiziert und so mit der Klassenzuteilung stigmatisiert. Da hört es bei mir definitiv auf – weil keine vernünftigen Lösungen mehr möglich sind. Konsequenterweise würde das bedeuten, dass auch die Oberstufen und die Gymnasien abgeschafft werden. Da sagte mir die Person, ja, das sei auch ihr politisches Ziel. Ich finde das äusserst bedenklich.
Worauf kommt es letztlich an?
Auf die Durchlässigkeit – zur richtigen Zeit in der richtigen Klasse. Aus den Sonderschulen – der separativen Beschulung – kommen die Kinder, einmal zugeteilt, selten wieder weg. Ich bin selbst ein gutes Beispiel für Durchlässigkeit an den Volksschulen: Ich bin von der Real-, über die Sekundar- zur Bezirksschule gekommen. Wenn es uns gelingt, das zu kommunizieren, lösen sich die Grabenkämpfe.
Haben Sie sich das Budget dafür schon gemacht?
Die Schaffung neuer Angebote in den Gemeinden soll uns weder günstiger noch teurer kommen. Wir müssen die vorhandenen Mittel einfach effizient einsetzen.
Mehr Förder- oder Kleinklassen sind doch teurer, weil dort weniger Kinder gleichzeitig unterrichtet werden. Es braucht mehr Lehrer.
Ein Sonderschulplatz kostet ca. 70’000 Franken pro Jahr. Für das Schuljahr 2025/26 haben wir voraussichtlich für rund 200 Kinder mit entsprechendem ausgewiesenem Bedarf keinen Sonderschulplatz. Wir unterstützen die Schulen vor Ort deshalb mit der Möglichkeit, regionale Spezialklassen zu schaffen. Der Kanton übernimmt die Kosten dafür. Dort sollen die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen durch Heilpädagogen unterrichtet werden. Natürlich sind wir für das neue Schuljahr viel zu spät, aber sind wir ehrlich, auch in den kommenden Jahren werden wir zu wenig Sonderschulplätze haben. Daher sollten die Schulen vor Ort diese neue Möglichkeit nutzen. Die Alternative ist, dass diese Kinder entweder zurückgestellt oder auf die Regelklassen verteilt werden, welche dann in ihrer Tragfähigkeit gefährdet sind. Und das kann doch nicht die Lösung sein.
«Aus den Sonderschulen – der separativen Beschulung – kommen die Kinder, einmal zugeteilt, selten wieder weg.»
Die zweite Landessprache an den Primarschulen, insbesondere das Frühfranzösisch, kommt politisch in manchen Kantonen unter Druck. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Eine Vorbemerkung: Im Kanton Aargau starten wir mit Frühenglisch. Jedoch brachte die Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) in Französisch Haarsträubendes zutage. In der Realschule erfüllen gerade noch sieben Prozent die Grundanforderungen. Aufgrund der schlechten Resultate arbeiten wir nun eine Sprachenerwerbsstrategie aus. Die Stossrichtung werden wir in den nächsten Monaten diskutieren. Persönlich bin ich für eine pragmatische Haltung: Wir müssen uns fragen, was die Jugendlichen wirklich können müssen, wenn sie die Volksschule verlassen. Klar ist: Wer in die Kanti geht, braucht das Französisch. Es ist aber nicht bei jeder Berufslehre Voraussetzung. Vor diesem Hintergrund ist die Frage erlaubt: Welchen Sinn macht Französisch auf Realstufe, wenn nur noch sieben Prozent die Grundanforderungen erreichen. Da wäre es mir lieber, wenn wenigstens die Deutschkompetenzen ausreichend gestärkt würden. Und dort haben wir gerade an der Realschule ebenfalls ein grosses Problem.
Sie würden also den Französisch-Unterricht an der Realschule streichen?
Das kann ich zurzeit nicht sagen. Wir müssen erst wissen, was die Berufsschulen wirklich benötigen. Die eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz EDK fordert auf Primarstufe zwei Fremdsprachen. Und das haben wir im Grunde genommen auch im Kanton Aargau: mit Englisch und Hochdeutsch. Für die Aargauer ist Hochdeutsch auch eine Fremdsprache (lacht). Nein im Ernst, ich erhoffe mir von der EDK schon mehr Flexibilität. Rückblickend würde heute wahrscheinlich niemand mehr auf die Idee kommen, dass man das Startschuljahr der Fremdsprache ins Konkordat schreibt. Es ist doch wichtig, welches Niveau ein Schüler am Ende der Volksschule erreicht, und nicht, wann er mit welcher Fremdsprache startet.
Und schon hebt Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wie seinerzeit auch alt Bundesrat Alain Berset – das Stopp-Fähnchen. Finden Sie die Einmischung der Romandie-Bundesräte in die Bildungshoheit der Kantone für berechtigt?
Nein, die grosse Stärke unserer Bildungspolitik ist, dass sich der Bund nicht einmischt. Er hat gewiss andere Probleme, als sich mit den Kantonen anzulegen.
«Die grosse Stärke unserer Bildungspolitik ist, dass sich der Bund
nicht einmischt. Er hat gewiss andere Probleme,
als sich mit den Kantonen anzulegen.»
Zum Thema Digitalisierung: Nach dem Kanton Nidwalden hat auch der Aargau ein flächendeckendes Handyverbot ausgesprochen, das jetzt mit Beginn des Semesters aktiv ist. Was war der Auslöser für dieses Verbot?Alle diese elektronischen Geräte sind ein Riesenproblem, nicht nur an den Schulen, auch ausserhalb. Der Medienkonsum der Kinder hat exponentiell zugenommen – man spricht nicht mehr miteinander, man spielt nicht mehr in der Pause. Viele Schulen kannten darum schon ein Verbot. Auf deren guten Erfahrungen konnten wir aufbauen. Jetzt wird der Handygebrauch auf Verordnungsstufe einheitlich geregelt. Somit haben wir weniger Diskussionen und mehr Sicherheit vor Ort. Ich habe nur positive Rückmeldungen. Die Eltern sind froh darüber, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen ebenso. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass andere Kantone folgen werden. Im Wallis ist das ja jetzt bereits geschehen.
Wir vom Lehrernetzwerk Schweiz erkennen aber eine grosse Diskrepanz: Die Schul- und Bildungsverwaltungen und auch die Lehrmittelverlage pushen die Digitalisierung – mittlerweile schon auf Kindergartenstufe. Gleichzeitig legt man den Eltern nahe, den Medienkonsum zu reduzieren.
Natürlich ist das ein Widerspruch. Wir revidieren zurzeit das Volksschulgesetz. Und in diesem Zusammenhang sind aus dem Parlament auch noch Vorstösse zu behandeln, die verlangen, dass der Kanton Mindestvorgaben für die Ausstattung der digitalen Geräte an den Schulen machen sollte. Hintergrund dieser Vorstösse war die Befürchtung, dass finanziell schwächere Gemeinden die Schulen computertechnisch nur ungenügend ausstatten könnten und dies zu Ungleichheiten führe. Vom Kanton aus definieren wir nun die Mindestanforderungen. Klar ist für mich: Wir werden die Mindestvorgaben sehr zurückhaltend gestalten. Wir können nicht auf privater Seite die elektronischen Mittel verbannen wollen, während wir schon im Kindergarten jedem Kind ein Tablet in die Hand drücken.
Ist der Lehrermangel noch ein Thema?
Ja, noch immer. Aber die Massnahmen scheinen jetzt zu greifen. Die Pädagogischen Hochschulen (PH) bilden inzwischen mehr Lehrerinnen und Lehrer aus, und es gibt heute auch mehr Wege, um Lehrer zu werden.
Die Lehrerverbände haben sich dagegen gewehrt, dass Berufsmaturanden ohne Hindernisse für die Primarlehrerausbildung zugelassen werden. Wie stehen Sie dazu?
Ich habe mich als Nationalrätin dafür eingesetzt, dass man mit der Berufsmaturität auch an die PH darf. Das Thema ist nicht unter den Tisch gefallen. Ich finde es auch für den Lehrerberuf wichtig, dass wir Menschen haben, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die Praxiswissen und Lebenserfahrung mitbringen, nicht nur Akademiker. Ein guter Mix ist immer eine Bereicherung.